
Das Christkönigsfest
Das Christkönigsfest wurde im Jahr 1925 durch Papst Pius XI. anlässlich der 1600-Jahr-Feier des Konzils von Nicäa eingeführt. Ursprünglich am letzten Sonntag im Oktober gefeiert, legte es die Liturgiereform auf den letzten Sonntag im Kirchenjahr. Die Bedeutung dieses Festes legt der Papst in seiner im gleichen Jahr erschienenen Enzyklika "Quas primas" dar. Pius XI. sieht in der Anerkennung der Königsherrschaft Christi das wirksamste Heilmittel gegen die zerstörenden Kräfte der damaligen Zeit. Er sieht das Königtum Christi als ein dreifaches an. So ist Christus sowohl Gesetzgebet als auch Richter und ihm kommt zudem die ausführende Gewalt zu. In das Königreich Christi aber tritt der Mensch ein durch Buße und Umkehr und die innere Wiedergeburt durch die Taufe. Doch wenn auch die Königsherrschaft Christi zunächst eine geistliche ist, so erstreckt sie sich doch auch auf die bürgerlichen Angelegenheiten. So heißt es am Ende er Enzyklika:
Für die Staaten aber wird die alljährliche Feier dieses Festes eine Mahnung sein, dass die Staatenlenker und Behörden, so gut wie die einfachen Bürger, die Pflicht haben, Christus öffentlich zu ehren und ihm Gehorsam zu leisten. Sie wird stets den Gedanken an jenes Jüngste Gericht in ihnen wachhalten, bei dem Christus, der aus dem öffentlichen Leben verbannt und aus Verachtung vernachlässigt und übergangen wurde, unerbittlich streng solch schmähliche Misshandlung rächen wird. Es ist eine Forderung seiner göttlichen Würde, dass die ganze menschliche Gesellschaft sich nach den göttlichen Gesetzen und den christlichen Grundsätzen sichte, sowohl in der Gesetzgebung und in der Rechtsprechung, wie auch in der Heranbildung der Jugend zu gesunder Lehre und zu sittlicher Unbescholtenheit.
Wunderbar ist es sodann, welch sittliche Kraft und hohe Tugend die Gläubigen aus der Erwägung dieser Wahrheiten gewinnen können, um ihre Seelen gemäß dem wahren, christlichen Lebensideal heranzubilden. Wenn nämlich Christus, dem Herrn, alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, wenn die Menschen, die mit seinem kostbaren Blute erkauft sind, unter einem neuen Gesichtspunkt seiner Herrschaft unterworfen werden, wenn endlich diese Herrschaft das ganze menschliche Wesen umfasst, dann ergibt sich daraus, dass keine einzige Fähigkeit sich dem Einfluss dieser höheren Gewalt entziehen darf.
Christus soll also herrschen über den Verstand des Menschen, der in vollkommener Unterwerfung seiner selbst den geoffenbarten Wahrheiten, den Lehren Christi fest und beständig beipflichten muss; herrschen soll Christus über den Willen, der den göttlichen Gesetzen und Vorschriften folgen muss; herrschen soll er über das Herz, das die natürlichen Gefühle zurückdrängen und Gott über alles lieben und ihm allein anhangen muss; herrschen soll er im Leibe und in seinen Gliedern, die als Werkzeuge oder, um mit dem Apostel Paulus zu reden, als Waffen der Gerechtigkeit für Gott zur inneren Heiligung der Seele dienen sollen. Wenn all diese Gedanken den Gläubigen zur Betrachtung und Beherzigung vorgelegt werden, so werden sie umso leichter zur höchsten Vollkommenheit gelangen.
Auch wenn das Christkönigsfest ein sehr junges Fest ist, so ist der Inhalt dieses Festes, das Königtum Jesu Christi, schon immer fest im Glauben der Kirche verwurzelt. Christus selbst bezeichnet sich als König, doch sein Königtum ist nicht von dieser Welt. Als er vor Pilatus steht fragt ihn dieser: "Also bist du doch ein König?" Und Jesus antwortet: "Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, damit ich für die Wahrheit Zeugnis ablege." (Joh 18,36f.)
Nachdem das Christentum im römischen Reich Staatsreligion wurde, entstanden viele große Kirchen im Baustil der Basilika. Basileus, das war der Herrscher des römischen Reiches und die Basilika ist die Königshalle. Die ersten großen Kirchen wurden also den Königshallen nachempfunden. Nur stand in der Apsis, dem halbrunden Abschluß des Gebäudes, nicht mehr der Thron des Kaisers, sondern der Altar und darüber befindet sich ein riesiges Mosaik, in dem Christus als Pantokrator, als Allherrscher, dargestellt wird. Nicht der Kaiser ist der oberste Herr des Reiches, sondern Christus ist Herr über die ganze Welt und jedes ihrer Reiche. So hat man dann später auch die Könige als von Gottes Gnaden bezeichnet, die gleichsam im Auftrag des einen Herrschers, Christus, ihre Herrschaft ausüben.
Sicher verbinden viele mit dem Begriff Gottesgnadentum wie auch mit dem Begriff König an sich gemischte Gefühle. Woran denken wir, wenn wir heute den Begriff König hören? An eine frühere, heute unzeitgemäße Herrschaftsform? An die Stories aus der Regenbogenpresse, in denen Details aus dem Leben der Mitglieder heute noch existierender Herrscherhäuser publikumswirksam vermarktet werden? An alte Zeiten, an den Glanz der Monarchien in den Ländern Europas? Oder an die Könige aus unseren Märchenbüchern? Vielleicht mag ja die Sehnsucht nach einem guten und gerechten König, der für eine gerechte Ordnung in seinem Land sorgt, in uns sein. Dieser steht oft aber die Angst vor einem Willkürherrscher und die Abneigung gegen den Prunk der Herrscherhäuser, der oft auf Kosten der Bevölkerung ging, gegenüber. Ideal und Wirklichkeit stimmen beim Königtum selten überein. Auch an den Königen der Geschichte, die wir die "Großen" nennen, lassen sich so manche Schattenseiten finden.
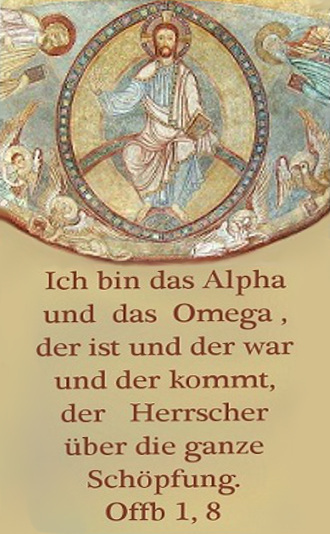
Vielleicht können wir einen Zugang zum Christkönigsfest finden, wenn wir in Christus den idealen König sehen, der ganz ohne Schattenseiten ist. Was wäre das Charakteristikum dieses Königs? Ich meine, er muss die Macht und die Güte in sich vereinen. Gerade die Verbindung von Macht und Güte zeichnet einen idealen Herrscher aus. Macht ohne Güte führt zu Willkür und Ungerechtigkeit, Güte ohne Macht aber kann das Gute nicht durchsetzen. Wir glauben, dass Gott allmächtig ist und dass er die vollkommene Liebe und Güte ist. Daher müsste es doch die Sehnsucht aller Menschen guten Willens sein, unter der Herrschaft dieses Gottes zu leben.
Absolute Macht und Güte begründen aber noch ein drittes, nämlich die Möglichkeit einer absoluten Wahrheit. Christus selbst bezeichnet als Ziel seines Königtums, für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Gott ist die absolute Wahrheit. Gott hat die Spuren dieser Wahrheit in seine Schöpfung gelegt und dem Menschen mit dem Verstand ein Werkzeug an die Hand gegeben, diese Wahrheit zu ergründen. Dass Gott die absolute Wahrheit ist, das ist die Bedingung der Möglichkeit jeder Wissenschaft. Die Welt ist nicht aus Zufall und Willkür entstanden, sondern hat als Schöpfer den allmächtigen und guten Gott, der in sie seine Ordnung gelegt hat. Wir glauben, dass Gott Vater alles durch Christus, den Sohn geschaffen hat. In Christus ist alles geschaffen und alles hat in ihm Bestand. Die ganze Schöpfung ist durch Christus. Dies ist der letzte Grund seines Herrscheranspruchs über die Welt.
Als vollkommen mächtig, gut, gerecht und wahr ist Christus auch der Garant für die Gerechtigkeit in dieser Welt. Als Allherrscher wird er oft mit dem Buch des Lebens in der Hand dargestellt, dem Buch, in dem bei Gott die Gerechten eingeschrieben sind.
Und dennoch mag uns ein Gefühl der Müdigkeit beschleichen angesichts dieser nicht enden wollenden Entwicklungen um das Christusbild. Immer neue Versuche, immer neue Bilder, immer neue Sprechweisen. Sind diese Erscheinungen nicht doch ein Zeichen dafür, dass irgendwo eine feste Basis verlassen wurde, und dass in unserem religiösen Vorandrängen etwas ins Schwanken und Gleiten geraten ist?
Oder war es ein Rundgang, auf den wir uns vor zwei Jahrtausenden begeben mussten, um die Reichtümer Christi in immer neuen Schichten sehen zu lernen - erst in ihrer gesammelten Schönheit, dann aber auch in ihrer Auflösung, in ihrer historischen Entfaltung, in ihrer inneren Tiefe und in ihrer äußeren Würde?
Es dürfte dieses letztere der Fall sein. Und es scheint, dass der Kreis sich schließen will und dass der Rundgang nun wieder zu seinem Ausgangspunkt zurückkehrt.
Diese Worte des großen Liturgiewissenschaftlers J.A. Jungmann können uns helfen, das Christkönigsfest auch heute besser zu verstehen. Es soll unser Christusbild bereichern. Die Evangelien stellen uns in jeder Messfeier Christus dar. Sie zeigen uns die liebevolle Zuwendung Gottes zu uns Menschen, die in Jesus Christus konkret wird.
Eine zu einseitige Sicht auf den Menschen Jesus Christus hat uns aber den Blick auf seine Göttlichkeit verstellt. Hier kann das Christkönigsfest uns helfen, wieder zur Gesamtschau des Christusbildes zu gelangen, denn auch das Bild von Christus als Weltenherrscher, "der ist und der war und der kommen wird" (Offb 1,8) ist ein zutiefst biblisches Bild.
Hatte Papst Pius XI. bei seiner Festlegung des Festes auf den letzten Sonntag im Oktober bereits den eschatologischen Charakter dieses Festes betont, so kommt dieser nun am letzten Sonntag im Kirchenjahr, auf den die Liturgiereform dieses Feste gelegt hat, noch besser zum Ausdruck, wie es das II. Vatikanum am Ende von "Gaudium et Spes" formuliert:
Der Herr ist das Ziel der menschlichen Geschichte, der Punkt, auf den alle Sehnsüchte der Geschichte und der Zivilisation zulaufen, der Mittelpunkt des Menschengeschlechts, die Freude aller Herzen und die Erfüllung ihrer Bestrebungen. ... In seinem Geist belebt und geeint, pilgern wir der Vollendung der menschlichen Geschichte entgegen, die mit dem Plan seiner Liebe übereinstimmt, alles in Christus zu erneuern, was in den Himmeln und was auf der Erde ist.
Herr Jesus Christus,
lass mich erkennen,
wie du verborgen
regierst als Herrscher der Welt,
so wie du einst bei deinem Tod am Kreuz
über Sünde und Tod triumphiert hast.
Lass mich darauf vertrauen,
dass deine Macht stärker ist
als die Mächte dieser Welt,
dass ich mich vor nichts fürchten muss
und du mir immer Kraft gibst.
Herr Jesus Christus,
zeige dich den Gläubigen
als Herrscher der Welt
dass wir mutig eintreten
für dich und für die Menschen,
die uns anvertraut sind.
Zeige uns,
wie dein Name die Welt verändert.
Lass uns schon jetzt in dieser Welt
in deinem Namen siegreich sein
und bei deinem Kommen in Herrlichkeit
mit dir und dem Vater
vereint sein in Ewigkeit.
Amen.
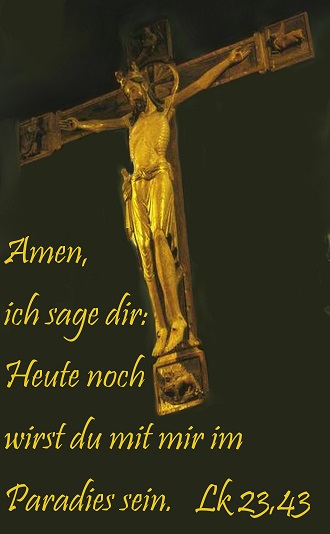
König auf dem Kreuzesthron
"Du König auf dem Kreuzesthron!" So singen wir in einem Lied. Christus am Kreuz - ein gekreuzigter Gott-König, das übersteigt die Vorstellungskraft vieler Menschen.
Christkönig - wer erkennt in dem Gekreuzigten den König des Himmels und der Erde, der den schmachvollen Tod auf sich nimmt, um die Welt von der Schmach der Sünde und es Todes zu befreien?
Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein!
Sünde und Tod haben nicht das letzte Wort, sondern in der Auferstehung entsteht neues Leben, unvergänglich und herrlich. Jesus lädt uns ein, an diesem Leben teilzuhaben. Ein Wort genügt.
Jesus, denk an mich! Der Herr vergisst dich nicht.
König mitten in unserer Welt
Christus ist ein König, der seine Legitimation nicht von irgendeiner irdischen Macht empfangen hat, sondern vom Himmel, von Gott seinem Vater. Daher hat sein Königtum auf ewig Bestand und kann von keiner Macht bezwungen werden. Jesus ist aber kein König einer fernen Welt und Zeit, sondern sein Reich ist schon mitten unter uns. Das Reich Gottes ist zwar nicht von der Welt, aber doch mitten in dieser Welt. Daher kann man sagen, dass das Reich Gottes, die Königsherrschaft Christi, das Reich seines Vaters nicht etwas ganz von dieser Welt Verschiedenes sind, sondern auf wundersame, für uns nicht mit den Methoden der Naturwissenschaften erkennbare Weise, mit unserer Welt verbunden sind.
"Das Reich Gottes ist schon mitten unter euch." Ausgehend von diesen Worten möchte ich mit Ihnen das Christkönigsfest einmal auf eine eher ungewöhnliche Art und Weise betrachten. Ich finde nämlich dieses Wort Jesu in einer Szene des berühmten Isenheimer Altars in Colmar besonders eindrucksvoll dargestellt. Was zeigt dieses Bild?
Auf der linken Seite werfen wir einen Blick in den Himmel. Es sind Engel dargestellt, die auf vielfältige Weise und mit den verschiedensten Instrumenten eine himmlische Symphonie erklingen lassen. Auf der rechten Seite ist Maria zu sehen, wie sie liebevoll ihr Kind im Arm hält. Mutter und Kind sehen sich auf eine für die Zeit des 15./16. Jahrhunderts völlig außergewöhnliche Weise direkt an und scheinen ineinander zu verschmelzen. Bei der linken und rechten Bildhälfte scheint es sich auf den ersten Blick um zwei Welten zu handeln. Wenn man das Bild genauer betrachtet, so sieht man, daß die beiden Hälften durch einen in der Mitte hängenden Vorhang voneinander getrennt sind, doch der Vorhang reicht nicht bis zum Boden. Im unteren Teil des Bildes besteht eine Verbindung zwischen den beiden Hälften. Die Badewanne für das Kindlein beispielsweise steht ganz weit im himmlischen Bereich.
Dies läßt sich sicher auf vielerlei Weise deuten. Für mich symbolisiert die Badewanne die Notwendigkeiten des irdischen Daseins, wozu eben auch die Körperpflege gehört. Christus ist ganz Mensch geworden und ihm waren die Notwendigkeiten der irdischen Existenz nicht fremd. Wenn aber dem Sohn Gottes menschliches nicht fremd ist, so zeigt das auch, daß den Himmelsbewohnern die Notwendigkeiten der Menschen nicht verborgen sind, vor allem aber auch, daß Gott uns in unseren Leiden ganz nahe ist. Die Menschen müssen sich um das kümmern, was zum irdischen Leben gehört und können auch dem Leid nie ganz entfliehen, aber sie dürfen sich dabei auch himmlischer Hilfe sicher sein.
Worauf es aber im Leben wirklich ankommt, sehen wir, wenn wir Maria mit dem Jesuskind betrachten. Maria ist mit ihrem Kind ganz eins, der Blick auf Christus verleiht ihr Seligkeit. Das will uns zeigen, daß auch wir in unserem Leben den Blick auf Christus werfen sollen. Durch das Gebet, vor allem das stille betrachtende Gebet, gewährt Gott jedem Menschen diesen innigen Kontakt mit sich, wir können hier auf Erden schon ganz eng mit Gott verbunden sein, so wie im Bild Maria mit ihrem göttlichen Kind. Dann befinden wir uns eigentlich nicht mehr in dieser Welt. Wir sind der jenseitigen Welt schon ganz nah, jener Welt, die der Maler durch das Musizieren der Engel dargestellt hat.
Und nun zum Geheimnis des Vorhangs: Die jenseitige Welt ist uns auch real gar nicht fern, wir können sie nur nicht sehen, weil uns gleichsam ein Vorhang von ihr trennt. Das bedeutet es, wenn Christus uns sagt, daß das Reich Gottes schon mitten unter uns ist. Es ist uns ganz nah, aber wir können es nicht sehen, weil unseren Sinnen die Möglichkeit fehlt, das wahrzunehmen, was nicht unserer Sinnenwelt entspricht. Aber nur, weil wir etwas nicht sehen können, heißt es ja nicht, daß es das auch nicht gibt. So ist auch das Königtum Christi mitten in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Es ist unsichtbar aber nicht unwirksam unter uns gegenwärtig. Durch das Gebet kommen wir Christus ganz nahe und selbst in unseren irdischen Nöten ist er uns nicht fern.
Das Reich Christi ist auch kein Schattenreich am Rande dieser Welt, es ist vielmehr das Reich des wahren Lichtes. Christus ist das wahre Licht und wo Menschen Christus dienen, da erstrahlt auch in dieser Welt schon sichtbar jener Glanz, den wir in seiner Fülle dann auf ewig schauen dürfen, wenn Christus einst wiederkommt. Dann wird uns sein Reich auch nicht mehr wie hinter einem Vorhang verborgen sein, sondern jene, die Gott für würdig hält, dürfen Gott dann schauen wie er ist.