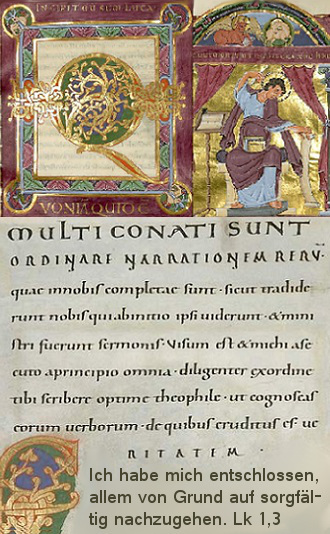
Sorgfältig und Zuverlässig
Nun habe auch ich mich entschlossen, allem von Grund auf sorgfältig nachzugehen,
um es für dich, hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben.
Sorgfalt und Zuverlässigkeit, das sind die Kernworte aus dem Vorwort des Lukas-Evangeliums. Lukas schreibt sein Evangelium etwa 50 Jahre nach den Ereignissen, von denen er berichtet. Vieles ist seither geschehen. Die Menschen sind vielleicht auch verunsichert, ob sie dem Vertrauen schenken können, was die Christen verkünden.
Als Quelle seines Evangeliums dienen Lukas Berichte, die zu seiner Zeit im Umlauf sind und die sich auf die Überlieferung der Menschen stützen, die selbst Augen- und Ohrenzeugen Jesu Christi gewesen sind. Es müssen also zur Zeit des Lukas schon verschiedene Aufzeichnungen über Leben und Wirken Jesu Christi im Umlauf gewesen sein. Besonders denken wir dabei an das ältere Markus-Evangelium und die Logienquelle, eine nicht mehr vorhandene Sammlung von Worten und Taten Jesu Christi.
Diese Quellen hat Lukas sorgfältig überprüft, damit zum einen der Adressat des Evangeliums, ein gewisser Theophilus, aber auch alle Menschen bis hin zu uns heute sich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen können, in der sie unterwiesen wurden.
Das, wovon Lukas berichtet, ist von höchster Bedeutung. Im zweiten Abschnitt des heutigen Evangeliums hören wir den Bericht von der ersten öffentlichen Rede Jesu.
Heute hat sich das Schriftwort erfüllt.

Nach seiner Taufe durch Johannes und den Tagen der Versuchung in der Wüste ist Jesus nach Galiläa zurückgekehrt. Anders als Markus und Matthäus, die das erste Auftreten Jesu am See von Galiläa und in Kafarnaum lokalisieren, lässt Lukas Jesus seine erste öffentliche Rede in der Synagoge seiner Heimatstadt Nazaret halten.
Versuchen wir uns die Situation in Nazaret vorzustellen. Die Leute dort kannten Jesus gut, er scheint aber bisher nicht sonderlich aufgefallen zu sein. Sicher ist es nicht das erste Mal, dass Jesus in der Synagoge dort vorliest, denn dies kommt jüdischen Jungen ab dem 13. Lebensjahr zu und es ist anzunehmen, dass Jesus wie jeder andere jüdische Junge aufgewachsen ist.
Doch an diesem Tag ist es anders. In den Wochen vorher hat Jesus erkannt, dass nun die Zeit dafür gekommen ist, das zu tun, wozu er gesandt ist. Wenn Jesus früher in der Synagoge einen Text vorgetragen hat, so wird er ihn nach den geltenden Regeln ausgelegt haben, so wie er es als Kind im Tora-Unterricht gelernt hat. Jetzt ist es anders:
Heute hat sich das Schriftwort erfüllt - ich bin der, von dem Jesaja spricht. In den Worten des Propheten erkennt Jesus seine eigene Berufung und Sendung:
Der Herr hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe; damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht; damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe.
Den Armen die gute Nachricht bringen
Jesus wird gesandt, den Armen eine frohe Botschaft zu verkünden, indem er ihnen nämlich sagt:
Selig ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. (Beda Venerabilis)
In der Feldrede des Lukasevangeliums (Lk 6,20) wird Jesus ganz gezielt die Armen als Adressaten der Botschaft vom Reich Gottes ansprechen. Gerade diejenigen, die sonst keine Chance haben, werden von Gott bevorzugt behandelt. Wir müssen auch heute unsere Verkündigung des Evangeliums immer wieder daran messen, welchen Platz bei uns die Armen haben. Sehen wir sie nur als Almosenempfänger oder als vollwertige Glieder der Kirche?
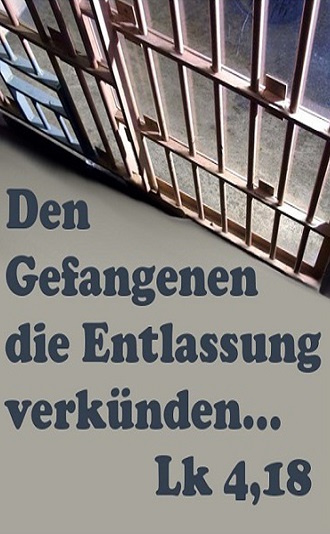
Den Gefangenen die Entlassung verkünden
Schlimm ist die leibliche Gefangenschaft, die von einem körperlichen Feind kommt. Schlimmer noch ist eine geistige Gefangenschaft, von der aber wird hier gesprochen: Die Sünde nämlich übt eine Gewaltherrschaft der übelsten Sorte aus, indem sie gebietet, Schlechtes zu tun, und die, die ihr gehorchen, ins Verderben stürzt. Aus diesem geistigen Gefängnis aber hat uns Christus befreit. (Johannes Chrysostomus)
Wir dürfen aber die Gefangenschaft nicht nur im übertragenen Sinne sehen, sondern auch ganz konkret. Gerade in totalitären Regimen gibt es viele Menschen, die unschuldig in Gefängnissen sitzen, die wegen ihrer Überzeugung oder ihres Andersseins eingesperrt sind - auch in unserer Zeit. Wenn wir den Auftrag Christi erfüllen wollen, müssen wir uns für die Freiheit dieser Menschen besonders einsetzen.
Den Blinden das Augenlicht verkünden
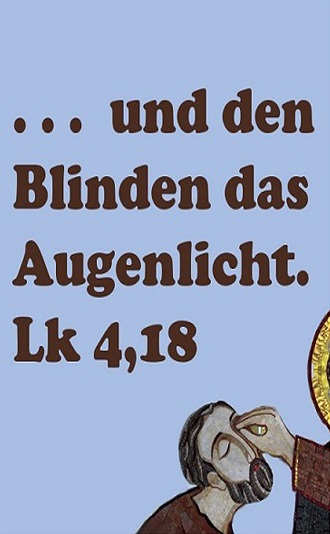
Mehrere Blindenheilungen werden von Jesus berichtet. Der Blinde steht am Rand der Gesellschaft, ist abhängig von einem, der ihn führt und von den Almosen der Menschen. Jesus ruft diese Menschen wieder in die Gesellschaft zurück.
Der Blinde steht aber auch symbolisch für den Menschen, der Gott nicht erkennt, der mit den Augen des Leibes zwar sehen kann, aber nicht mit den Augen des Herzens. Besonders Markus positioniert die beiden Blindenheilungen Jesu an zentralen Schnittstellen seines Evangeliums und zeigt damit, dass Jesus Worte und Taten uns zu einem tieferen Sehen führen wollen.
Johannes schildert im 9. Kapitel seines Evangeliums sehr ausführlich eine Blindenheilung. Die Pharisäer wollen dieses Wunder Jesu nicht anerkennen und stoßen den Geheilten aus der Synagoge aus. Als sie mit Jesus darüber streiten fragen einige von ihnen: Sind etwa auch wir blind? Und Jesus antwortet: Wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Sünde. Jetzt aber sagt ihr: Wir sehen. Darum bleibt eure Sünde.
Auch wir sind oft blind, obwohl wir alles klar und deutlich zu sehen meinen. Herr, heile du die Blindheit unseres Herzens und lass uns erkennen, was wirklich wichtig ist.
Die Lehre der Christen ist nicht eine abstrakte Lehre über eine ferne Gottheit, sondern ganz nah, im Heil des Alltags, zeigt sich das Wirken Gottes. Dass sich all dies wirklich in diesem Jesus erfüllt hat, davon kündet uns das Evangelium.
Doch dieses Heute der Erfüllung ist nicht auf das Auftreten Jesu Christi beschränkt. Dieses Heute bleibt nach der Auferstehung Jesu Christi dauernde Wirklichkeit auf Erden. Im Glauben an Jesus Christus sind die Menschen zu allen Zeiten aufgerufen, das Heil Gottes in dieser Welt erfahrbar zu machen.
Das Handeln Jesu Christi im Heute gegenwärtig zu setzen, das ist der Auftrag an alle Christen. Sie können sich darauf verlassen, dass Jesus Christus wirklich der Sohn Gottes ist, in dem Gott den Menschen die Erfüllung seiner Verheissungen gebracht hat und der bleibend unter den Menschen gegenwärtig ist.
Folgendes Gebet habe ich gefunden. Es zeigt, was die Aufgabe von uns Christen heute ist:
Was keiner wagt, das sollt ihr wagen.
Was keiner sagt, das sagt heraus.
Was keiner denkt, das wagt zu denken.
Was keiner anfängt, das führt aus.
Wenn keiner ja sagt, sollt ihrs sagen.
Wenn keiner nein sagt, sagt doch nein.
Wenn alle zweifeln, wagt zu glauben.
Wenn alle mittun, steht allein.
Wo alle loben, habt Bedenken.
Wo alle spotten, spottet nicht.
Wo alle geizen, wagt zu schenken.
Wo alles dunkel ist, macht Licht.
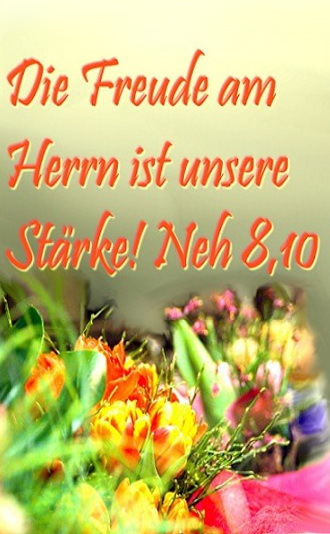
Die Freude am Herrn ist unsere Stärke
Das Buch Nehemia, aus dem wir heute die erste Lesung hören, berichtet über die Zeit nach dem babylonischen Exil. Viele Juden sind in das gelobte Land zurückgekehrt, der Tempel wurde wieder aufgebaut und Jerusalem mit einer Stadtmauer gesichert. Allmählich kehrt nach der unruhigen Zeit des Anfangs der Alltag ein und dieser soll geprägt sein von einem Leben nach dem Gesetz des Herrn.
Der Schriftgelehrte Esra liest dem ganzen Volk aus den Büchern des Gesetzes vor und gibt Erklärungen dazu. Alle sind betroffen, als sie diese Worte hören. Das Gesetz Gottes soll das Leben der Menschen bereichern, seine Befolgung soll allen zu einem frohen und glücklichen Leben verhelfen. Die Verkündigung des Gesetzes wird mit einem fröhlichen Fest verbunden. Die Menschen sollen neuen Mut finden in dieser unsicheren Zeit. Esra ruft ihnen zu:
Macht euch keine Sorgen; denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. (Neh 8,10)
Die Freude am Herrn ist unsere Kraft und Stärke. Dies ist ein Wort auch für unseren Alltag. Gott ist bei uns, er will mit uns gehen und uns reichlich beschenken, wenn es uns an etwas fehlt. Es gilt stets positiv nach vorne zu sehen und im Vertrauen auf den Herrn den nächsten Schritt zu wagen, voller Freude und Zuversicht.
Die Kirche als Leib Christi
Es ist nicht zuletzt das Verdienst des Zweiten Vatikanischen Konzils, uns die Bedeutung des Bildes von der Kirche als Leib Christi wieder deutlicher in Erinnerung gerufen zu haben. "Bei der Auferbauung des Leibes Christi waltet die Verschiedenheit der Glieder und der Aufgaben.", so heißt es dort. Wie die hierarchische Struktur der Kirche, die sich in den Ämtern des Bischofs, Priesters und Diakons zeigt, durch göttliches Recht begründet und für die Kirche unverzichtbar ist, so ist auch das Zusammenwirken dieser Hierarchie mit dem Rest der Gläubigen, den sogenannten Laien, unverzichtbar. Jeder Gläubige hat seinen besonderen Platz in der Kirche, den nur er ausfüllen kann und an dem er das tun darf und auch tun soll, was seine Aufgabe ist. Nur durch das Zusammenwirken aller und den gegenseitigen Respekt kann die Kirche ihrer Sendung nachkommen.
In der heutigen Lesung führt Paulus das Bild vom Leib genauer aus und zeigt, dass alle Glieder dieses Leibes ihre je eigene Bedeutung haben und auch die höherwertigen nicht ohne die einfacheren Glieder bestehen können. So gibt es auch in der Kirche die verschiedenen Ämter und Dienste, die aufeinander angewiesen sind. Doch es sind nicht die Menschen, die die Kirche machen. Die Kirche ist nicht irgendein Leib, sondern der Leib Christi. Zunächst die Frage, wie dieser Leib entsteht. Hier sagt Paulus ganz deutlich, dass es die Taufe ist, die den einzelnen in den Leib Christi eingliedert durch den Heiligen Geist.
An dieser Stelle erscheint es sinnvoll, das Bild von der Kirche als Leib Christi um ein weiteres Bild, das vom Volk Gottes, zu erweitern. Gott hat die Welt aus Liebe geschaffen und er möchte bleibend in ihr sein. Als Zeichen seiner Gegenwart hat Gott sich im Alten Bund das Volk Israel erwählt und ihm seine Gebote und seine Weisung anvertraut. Als die Zeit erfüllt war, kam Gott selbst in der Gestalt seines Sohnes in diese Welt. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat Christus die Welt erlöst. Durch ihn ist der Zugang zum Volk Gottes nun allen Menschen möglich durch die Taufe. Er hat seinen Geist gesandt und durch ihn seine Kirche gegründet, die alle Völker der Erde im Glauben vereinen soll.
In der Eucharistie bleibt Christus gegenwärtig in dieser Welt und in ihr erhalten auch wir Anteil an Christus. Das Bild von der Kirche als Leib Christi ist somit untrennbar mit der Eucharistie verbunden. Wie die Taufe in den Leib Christi eingliedert, so ist es die Eucharistie, die diesen Leib zusammenhält. Christus stiftet Gemeinschaft durch die Eucharistie. Kirche entsteht daher nicht, weil sich Menschen mit gleichen Interessen zusammenfinden, sondern durch Teilhabe an Christus.
In der Tradition wird die Kirche auch als der mystische Leib Christi bezeichnet. Die Gestalt der Kirche zeigt sich eben nicht nur in ihrer irdischen Struktur, sondern sie ist vielmehr Zeichen einer anderen Wirklichkeit, Zeichen der bleibenden Gegenwart Gottes in dieser Welt. Somit ist die Kirche auch das Ursakrament. Durch sie soll allen Menschen dieser Welt das Heil zukommen. Auch wenn die Kirche diesen Auftrag nur unvollkommen erfüllt, weil sie hier auf Erden aus sündigen Menschen besteht, kommt ihr doch von Gott her bleibende Heiligkeit zu.
Christus wollte die Einheit der Kirche. Durch die Schuld der Menschen ging diese Einheit verloren und wir erleben die Christenheit in eine Vielzahl von Konfessionen und Glaubensrichtungen gespalten. Dies zeigt sich letzlich auch in der gegenseitigen Ausschließung von der eucharistischen Mahlgemeinschaft. Eine Trennung von der Kirche drückt sich ja gerade in der Exkommunikation, dem Ausschluß von der Eucharistiegemeinschaft, aus. Beten wir darum, dass die Christen wieder zu der Einheit in Jesus Christus zurückfinden, damit alle Gläubigen hinzutreten können zu dem Sakrament des eucharistischen Brotes, durch das die Einheit der Gläubigen, die einen Leib bilden in Christus, dargestellt und verwirklicht wird. Alle Menschen werden zu dieser Einheit mit Christus gerufen, der das Licht der Welt ist.